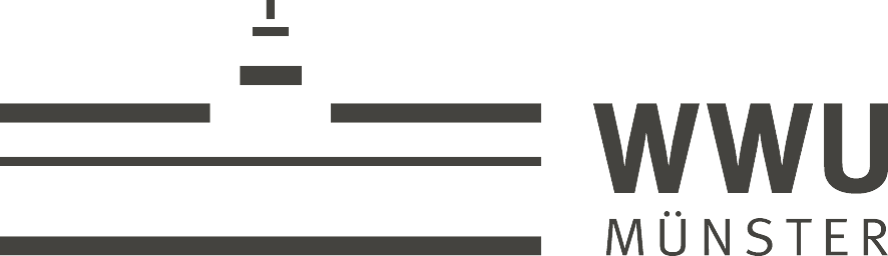In der Vorstellung vieler Akteure werden Begabungs- und Leistungsförderung als eine primär pädagogische, genauer methodisch-didaktische Frage verstanden. Damit wird aber die Verantwortung für das Gelingen wie für das Scheitern ausschließlich der einzelnen Lehrperson übertragen. Um Nachhaltigkeit und die gewünschten Ergebnisse in diesem Handlungsfeld zu erreichen, bedarf es aber über das kompetente Lehrerhandeln hinaus auch einer spezifischen begabungsfördernden, schulischen Organisation und stützender Strukturen. Diese greifen zum Teil über die gängige Lern- und Vermittlungsarchitektur hinaus und führen zu notwendigen Umstrukturierungen. Dann stellt sich die Frage, welche Formen und Strukturen von Organisation nötig sind und wie diese im Organismus einer Schule so entwickelt und ausgebildet werden können, dass sie dem pädagogischen Ziel der Begabungsförderung dienlich sind. Eine begabungsfördernde Lernpraxis und die dazu zu entwickelnden Strukturen bilden zudem die signifikanten Profilmerkmale einer begabungsfördernden Schule und bestimmen nicht unwesentlich deren Schulkultur und das Bild der Schule in der Öffentlichkeit.
In einem durch Reflexions- und Diskussionsphasen gegliederten Impulsvortrag werden Grundlagen, Formen und Hindernisse eines organischen Schulentwicklungsmodells entwickelt und einem sog. Implementierungsmodell gegenübergestellt. In Workshop-Elementen werden konkrete Modelle beider Schulentwicklungsformen analysiert.
Ziel ist es, über Modelle und Impulse eigenständige, d.h. „organische“ Schulentwicklungsprozesse anzuregen.