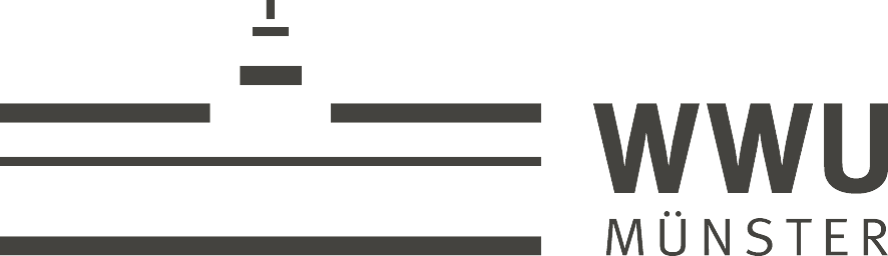Der aus den USA stammende Poetry-Slam stand bereits im pädagogischen Fokus, als das Verb slammen vor zehn Jahren in den Duden aufgenommen wurde. Zunächst schien der jugendkulturelle Dichterwettstreit der Postmoderne nur für den Deutschunterricht von Interesse zu sein: Poetry fokussiert neben der performativen Darbietung – auch als Dead or Alive- oder als Book-Slams – typische Inhalte des Faches Deutsch im Besonderen und der philologischen Fächer im Allgemeinen.
Inzwischen erfreuen sich in der Öffentlichkeit auch andere Slam-Formate großer Beliebtheit; in Science-Slams beispielsweise präsentieren (Nachwuchs-) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschungsprojekte „in zehn Minuten, verpackt in spannenden und anschaulichen Vorträgen“ (Scienceslam.de 2015). Solche bzw. adaptierte oder eigens kreierte Slam-Texte lassen sich nicht nur „als Lernimpulse“ einsetzen, wie es z.B. Andreas Fischer und Gabriela Hahn mit ihren „neuen Ideen für den sozioökonomischen Unterricht“ (2016) tun.
Insbesondere begabte und leistungsfähige Schülerinnen und Schüler können mittels differenzierender Individualisierung in die Lage versetzt werden, selbst solche Texte zu fachspezifischen Inhalten zu verfassen und – zum Benefit der inklusiven Lerngemeinschaft – vorzutragen. Die Werkstatt bietet neben den Grundlagen auch die Möglichkeit zur Diskussion, wie mittels einer kooperativen, fächerübergreifenden Unterstützung Vocation-Slams entstehen, vorgetragen (und auch benotet werden) können.
Kurzvita PD Dr. Beate Laudenberg